Hier kommt das alljährliche Humorkritik Spezial zu den DVD-Neuerscheinungen der Saison, so wie es in der aktuellen Titanic drin steht. Wer das Blog regelmäßig verfolgt, weiß eh schon alles — für alle anderen steht’s jetzt hier noch mal zum Nachlesen.
Die große Britcom-Koalition ist da!
Wir haben mal eben für Sie gewählt: Hier sind die besten Comedy-DVDs aus Großbritannien. Eines ist klar: they rule! In welchem Quatschministerium jeweils, das verrät Ihnen Britcom-Wahlexperte Oliver Nagel
Das ist eine Überraschung: absolute Mehrheit für die BBC! Nachdem im vorvergangenen Jahr Rupert Murdochs Bezahlsender Sky fast in allen Comedy-Wahlkreisen die Abstimmungen für sich gewinnen konnte, hat die alte Tante BBC 2013 wieder die Nase vorn. Nicht zuletzt, weil sie viele Themen besetzen konnte, die den Wähler interessierten: den Kriegseinsatz in Afghanistan (»Bluestone 42«) und Sterbehilfe (»Way to Go«), aber auch Integration islamischer Menschen in die westliche Gesellschaft (»Citizen Khan«) und Familie (»Family Tree«). Da blieb auch für ITV, das auf die Themen Arbeitsmarkt (»The Job Lot«) und Gleichstellung von Homosexuellen (»Vicious«) setzte, nur die Opposition – während Sky gleich ganz aus dem Fernsehparlament geflogen ist.
Aber der Reihe nach. Die wichtigste Rolle in der künftigen Britcom-Regierung wird wohl »The Wrong Mans« (BBC Two) spielen. Denn James Corden und Mathew Baynton (beide »Gavin & Stacey«-elder statesmen) schaffen es in diesem Agenten-Pastiche, mit den Versatzstücken des Genres zu spielen, ohne es dabei zu zerstören. Und so sieht man ihnen, zwei schnell überforderten städtischen Angestellten, atemlos dabei zu, wie sie sich in einen Entführungsfall verwickeln lassen, der Mi5-Agenten, russische Spione und überbesorgte Mütter auftischt und wieder abräumt, bevor ein einzelner Handlungsstrang zu lang wird. Die Fallhöhe zwischen Dingen, die Agenten eben so tun (etwa von Brücken auf fahrende Züge springen), und dem, wie durchschnittliche städtische Angestellte dieselbe Situation durchstehen (nämlich indem sie sich anschließend unter lautem »Au, au, au«-Heulen den Hintern massieren), hat das BBC2-Publikum mit den höchsten Einschaltquoten einer Comedy seit »Extras« belohnt, und das war immerhin schon 2005. Zu Recht, »The Wrong Mans« ist nämlich trotz seines wenig gelungenen Titels die beste Serie des Jahres und das Jack-Bauer-Ministerium damit besetzt.
Tom Basden, »Wrong Mans«-Co-Autor und -Nebendarsteller, hatte wohl ein gutes Jahr, denn er war in gleicher Funktion bei »Plebs« (ITV2) eingespannt, unserem Kandidaten für das Ministerium für Brot und Spiele. Wer immer schon mal wissen wollte, welche Probleme Jugendliche im alten Rom mit dem Heranwachsen hatten, dem sei die Serie empfohlen. Kleiner Tip: Sie sind heutigen Problemen verblüffend ähnlich. Wer hätte nicht schon mal überlegt, seinen Sklaven einfach vor dem Club stehen zu lassen, wenn man den Eintritt schon kaum für sich selbst bezahlen kann? »Plebs« ist für alle, die bislang ihr Kreuzchen bei »The Inbetweeners« gemacht haben: etwas für die männlichen Jungwähler.
Schöngeistiger geht es da im Dandy-Ministerium bei »Vicious« (ITV) zu: Die beiden Veteranen Sir Ian McKellen (ja, der aus »Herr der Ringe«) und der in England annähernd ebenso berühmte Sir Derek Jacobi geben in dieser ironisch-theatralischen Sitcom ein über die Maßen schwules Paar alternder Schauspieler, die ihre Verarmung mit allerhand Pathos überspielen und eine keineswegs nachlassende Vorliebe für junge Männer haben, namentlich den neuen Nachbarn (Iwan Rheon, »Misfits«, »Game of Thrones«). Altmodisch, live vor Publikum und grell, aber es ist halt immer wieder komisch, wenn sich flamboyante alte Diven gegenseitig beleidigen – zumindest wenn es mit so gewählten Worten wie hier geschieht und von altehrwürdigen Charakterdarstellern wie diesen gespielt wird.
Ebenfalls ein alternder Bühnenkünstler, aber mit viel gröberen Strichen gezeichnet, ist »Count Arthur Strong« (BBC Two). Er nervt, und zwar sehr – erst mal seine Umwelt, insbesondere Michael (Rory Kinnear), der ein Buch über Arthur (Steve Delaney) schreiben möchte, dann aber auch so manchen Zuschauer. Eine echte Marmite-Comedy: Man liebt sie oder haßt sie so wie den bitteren Brotaufstrich. Wahrscheinlicher, daß man sie liebt, wenn man »Father Ted« und/oder »Black Books« und/oder »The IT Crowd« mochte, denn »Count Arthur Strong« stammt nicht nur aus der Feder seines Darstellers, sondern auch von Graham Linehan. Der ist für einen eher albernen Humor bekannt, und doch schafft es Arthur in der zweiten Hälfte der Staffel auch in die Herzen seiner Zuschauer – obwohl er natürlich Quälgeist bleibt.
Sehr viel leiser dagegen geht es im Melancholie-Ministerium zu: »The Mimic« (Channel 4) ist die Studie eines höchst begabten Stimmenimitators (Terry Mynott), der seinem unterwältigenden Alltag mehr Pep verleiht, indem er ihn in den Rollen zahlloser Promis erlebt – bis ihn das überraschende Zusammentreffen mit seinem erwachsenen Sohn dazu zwingt, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Nicht ganz so ernst, wie es hier klingen könnte, sondern bisweilen sehr komisch, wenn Martin etwa mit der Stimme von Sir David Attenborough sein Privatleben als Wildlife-Dokumentation kommentiert.
Das Familienministerium geht an »Family Tree« (BBC Two) von Christopher Guest (siehe Humorkritik in Titanic 10/13).
»Ambassadors« (ebenfalls BBC Two) besetzt das Außenministerium in diesem Comedykabinett. David Mitchell und Robert Webb (»Peep Show«) ist ein dreiteiliges Comedy-Drama gelungen, das sophisticated und komisch zugleich ist. Niemand kann treuherziger gucken als David Mitchell, hier in der Rolle eines frisch ins Amt gehobenen Botschafters im fiktiven Tazbekistan, und niemand genervter als Webb, der hier den langgedienten stellvertretenden Chefdiplomat gibt und als solcher der Botschafter-Ehefrau Fragen nach dem Vorgänger ihres Mannes beantworten muß: »Does anyone know what actually happened to Keith’s predecessor?« — »Someone from the Cabinet Office thought they saw him recently in Phuket in a transvestite hammam. But technically he’s just missing.« — (Pause) »What was someone from the Cabinet Office doing in…?« Leider erscheint »Ambassadors« nicht mehr in diesem Jahr auf DVD.
Das Kultusministerium geht zu guter Letzt an David Walliams (»Little Britain«), der mit seiner ersten Sitcom »Big School« (BBC One) keinen ganz großen Wurf geschafft hat, aber eine solide, altmodische Sitcom, die wohl eine zweite Legislaturperiode erleben dürfte.
Acht gute bis sehr gute neue Comedys, das ist ein solides Wahlergebnis (von den zweiten und dritten Staffeln anderer Serien mal ganz zu schweigen) – da vergißt man schwache Kandidaten (wie Stephen Merchants fade Männer-Frauen-Sitcom »Hello Ladies«) schnell. Die Wahlparty kann beginnen! Und damit zurück ins Studio.
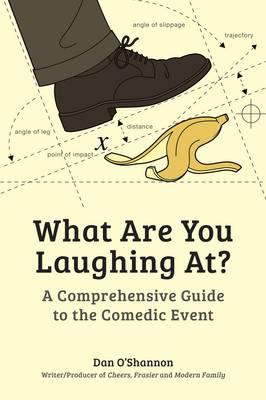
Neueste Kommentare